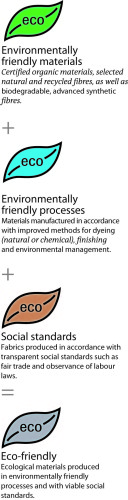Wenn Du nicht überzeugen kannst: Verwirre! – Ein alternativer Messebericht von den Pariser Stoffmessen Stoffe Sommer 2016 aus Sicht eines Überzeugungstäters
Nach einigen Jahren der Abstinenz hat es den Autor erstmals wieder zu einem der bekanntesten Standorte für Stoffmessen hingezogen: Paris.
Zum hinsichtlich Wetter unfreundlichen Februarbeginn kein Ort zum Flanieren oder für den Besuch eines Straßencafés. Statt dessen in einer nördlichen Vorstadt, strategisch günstig in Flughafennähe, zwei separate, sich zeitlich überschneidende Angebote: Die “Texworld” als “Massenmesse”, in der Orders unter 10.000 lfm als sehr klein gelten und bei der es in eher spartanischer Umgebung vornehmlich um Preise und Mengen (Originalton: “I need 50000 meters of that fabric, can you hit my pricelimit of 2,85 US$ per meter?”) geht.
Daneben die “Premiere Vision”, vor 25 Jahren die Speerspitze der Stoffmessen, insbesondere was Trends bei Materialien, Bindungen und Farben anging und heute noch ebenso liebevoll wie stilsicher inszeniert.
Inzwischen zeigen sich nicht mehr überwiegend Trends nur oder zuerst auf der Premiere Vision; es haben sich früher stattfindende Stoffmessen etabliert und die Trendberater in Halle 5 tun sich sich schwerer mit der digitalen Schwarmintelligenz, die der einstigen Vorherrschaft der Trendbüros mehr und mehr den Rang abläuft.
Auch ökologische Fragen haben auf beiden Messen eine gewisse Bedeutung gewonnen, ebenso soziale Fragen wie Arbeiterrechte und Arbeitsbedingungen. Wer jedoch – wie der trotz seines Alters noch hoffnungslos sozialromantische Autor – darauf gehofft hatte, dass sich aus den vornehmlich deutschsprachigen Insellösungen der frühen neunziger Jahre ein klare ökologische Alternative zum Massengeschäft durchsetzen würde, sah sich getäuscht:
Zwar ist inzwischen das GOTS-Label (Global Organic Textile Standards) eingeführt, welches eine Nachverfolgbarkeit der Materialien, die relative Umweltverträglichkeit der Produktionsprozesse sowie die Einhaltung von Grenzwerten von Textilchemikalien im Endprodukt und Mindestanforderungen für soziale Standards entlnag der textilen Produktionskette zusagt. Unscharf wird es bei näherem Hinsehen: Neben dem Standard “Fasern aus kontrolliert biologischen Anbau bzw. Wirtschaftsweise” (“Organic Textiles”) mit mindestens 95% ebensolcher Fasern gibt es noch den Standard “Textilien basierend auf mindestens 70% kontrolliert biologisch erzeugten Fasern”. Dies bedeutet, dass die restlichen 30 % Faser im Textil irgendwelche Natur- oder Chemiefasern sein dürfen und trotzdem ein GOTS-Label daran baumeln darf.

Für einen Minimalgehalt von 5% kontrolliert biologisch erzeugter Naturfasern sieht das Label recht “grün” aus.
Noch einen Schritt weiter (zurück) geht der OCS-Standard (Organic Content Standard) der sich ausschließlich mit der Herkunft und Nachverfolgbarkeit der verwendeten Rohstoffe, nicht jedoch mit den weiteren Produktionsschritten, befasst. Dieser OCS-Standard differenziert nochmals zwischen zwischen “OCS 100″ (mindestens 95% Fasern aus kontrolliert biologischer Erzeugung) und “OCS blended” mit einem Gehalt von mindestens 5% (in Worten: fünf Prozent) an Fasern aus kontrolliert biologischer Erzeugung. Das bedeutet, dass ein T-Shirt aus 93% konventioneller Baumwolle, 2% Elasthan und 5% Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau mit einem zumindest “grün” wirkenden Label ausgezeichnet werden kann. Dies ist nach dem – nicht justiziablen – Eindruck des Autors mehr eine Einladung zum Greenwashing als zum verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen des Planeten.
Ein weiterer, relativ neuer Zertifizierungstrend ist der ERTS-Standard (Ecological and Recycled Textiles Standard. Dieser steht für eine Verwendung von mindestens 70% konventioneller Naturfasern (z.B. Baumwolle) und/oder Fasern aus nachwachsenden Rohstoffen (z.B. Viskose aus Holz) und/oder recycelten Fasern (z.B. Polyester aus PET-Flaschen). Daneben wird auf gefährliche Chemikalienrückstände in den Endprodukten kontrolliert, der Wasser- und Energieverbrauch in der Produktion bestimmt sowie die Einhaltung von grundsätzlichen sozialen Standards überwacht. Mit anderen anderen Worten: dieser Standard ist gut geeignet, um recyceltes Polyester und Viskose bzw. Mischungen konventionell erzeugter Naturfasern zu vermarkten.
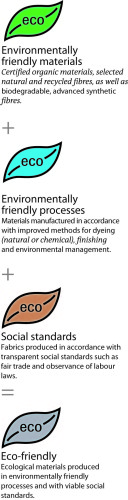
Hoffentlich gut gemeint, sicher nicht gut gemacht -Ökoinformationssystem der Messegesellschaft Frankfurt
Da muss es nicht verwundern, wenn die mengenmäßig und damit wirtschaftlich bedeutendere Messe “Texworld”, immerhin von der Frankfurter Messegesellschaft veranstaltet, auf diese unübersichtliche Lage noch einmal draufsattelt und ihre eigene Interpretation von textilem Eco-Labeling ihren Ausstellern und Besuchern zur Hand gibt. Aber selbst eine “Sustainable Lounge” kann nicht über die allgemeine Verwirrung der Veranstalter, Aussteller und Besucher hinwegtäuschen, hatte doch hinter keine der drei zufällig ausgewählten Stofflaschen dieser Sonderschau einen belastbaren realen Hintergrund an den Ständen der Hersteller (Originalton bei der Präsentation eines Handyfotos von eco-gelabelten Leinenstrick: “We do not have any organic linen, it must be an mistake”)
Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht vereinzelt “Überzeugungstäter” ihre korrekt über die gesamte Produktionskette gelabelten Stoffe aus mehr als 95% kontrolliert biologisch erzeugten Naturfasern anboten. Ihre Gesichter jedoch hatten den gleichen, irgendwie fragenden Ausdruck der Naturtextilpioniere der achtziger und frühen neunziger Jahre: Wie kann ich die ökologische Vorzüglichkeit meiner Stoffe kommunizieren? Und dann auch noch zu angemessenen Preisen verkaufen?
Aber Hand aufs Herz: wenn es den großen Konfektionären so leicht gemacht wird, aus billigeren, weil eigentlich nur nach guter fachlicher Praxis hergestellten, Stoffen auch noch irgendwie umweltfreundliche Kleidung auszuloben, welcher angestellte Produktmanager greift dann nicht mit gutem Gewissen bei entspannten Verhältnis zum Controlling zu?
Und wer ist nicht bereits am Kühlregal überfordert, wenn es zwischen “Heumilch”, “Weidemilch”, naturnah erzeugter Milch, Bioeigenmarke des Discounters oder regional erzeugter Biomilch mit der Geldbörse abzustimmen gilt?

Symptom für die richtige falsche Richtung: Google-Suchergebnis für “Ökolabel Textil” im Febraur 2015
Ach ja, neben dem Labelfrust und der Erkenntis, dass die Marktmechanismen sich in den letzten 25 Jahren nicht im Mindesten verändert haben, gab es noch eine Stofflust: Wird in der Sommermode 2015 noch viel Leinen in Mischungen mit Baumwolle und Viskose zu sehen sein, so stehen für den Sommer 2016 verschiedenste Reinleinen in den Startlöchern. Gebleicht und Natur, aber auch in der Fläche gefärbt und oft digital bedruckt.
Bedauerlicherweise für den Laien auf den ersten Blick fast nicht unterscheidbar, hängen beste Leinenstoffe von Solbiati aus Italien neben No-Names aus Pakistan. Aber das Problem des mangelnden Qualitätsbewußtseins hatten wir ja schon bei der Milch, immerhin sind für ein umso ausgeprägteres Preisbewußtsein nur die Grundrechenarten und kein Fingerspitzengefühl erforderlich.
Der geneigte Leser mag sich nun in Kenntnis der Grundrechenarten fragen, weshalb GOTS-gelabelte Textilien nur zu mindestens 95% aus kontrolliert biologisch erzeugten Naturfasern stammen müssen oder anders herum: Was ist mit den restlichen 5%? Das Rechenrätsel ist schnell gelöst. Farbstoffe wiegen auch, ebenso synthetische elastische Garne, ohne die funktional notwendige Bündchen nun mal nicht hergestellt werden können.
Er mag sich auch fragen, ob angesichts der baylonischen Verwirrung im Bereich der Kennzeichnung ökologisch vorteilhafter Textilien etwas falsch läuft. Der Autor fürchtet hingegen, dass hier nichts falsch läuft, sondern es genau richtig läuft: Eben nur nicht in die Richtung, die sich die Pioniere auf dem Naturtextilsektor vorgestellt haben, sondern in jene, die von den “Greenwashern”, den Marketingstrategien der Großunternehmen und dem zugehörigen Controlling gewünscht wird.
-
 enimport (Jens und Julia – vielen Dank!) Samen der Araucaria der neuen Ernte 2024 an. Das Aufkommen in Chile ist in diesem Jahr etwas höher als im Vorjahr, jedoch, der Preis ist jedoch auf vergleichsweise hohem Niveau geblieben.
enimport (Jens und Julia – vielen Dank!) Samen der Araucaria der neuen Ernte 2024 an. Das Aufkommen in Chile ist in diesem Jahr etwas höher als im Vorjahr, jedoch, der Preis ist jedoch auf vergleichsweise hohem Niveau geblieben.